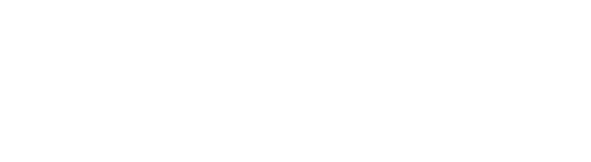Eine Einschätzung aus Baden-Württemberg von Sarah Händel
Die Entwicklung in Baden-Württemberg spiegelt ganz gut den allgemeinen Zeitgeist wider: Zunächst gab es eine Aufbruchstimmung und die Bereitschaft, die Bevölkerung auf ganzer Linie mehr zu beteiligen, auch mittels verbindlichen direktdemokratischen Entscheidungen. Gleichzeitig wurden Verwaltungsvorschriften zur frühen Beteiligung festgelegt, Netzwerke aufgebaut, Akzente durch Beispielprozesse gesetzt und die dialogische Beteiligung ausgebaut, mit einem frühen Fokus auf Bürgerforen mit Zufallsbürgern.
Doch die Harmonie der vielen Wege währte nicht allzu lange. Zunächst jagte der Brexit vielen Menschen einen nachhaltigen Schrecken ein, der dann noch getoppt wurde durch die Wahl Trumps. Ein Ereignis, das uns allen die Folgen gesellschaftlicher Polarisierung schonungslos vor Augen führte. Dazu kamen einige schwierige Erfahrung in Baden-Württemberg selbst. Zum Beispiel rund um einen neuen Nationalpark im Nordschwarzwald. Gegen eine auf Landesebene angesiedelte Frage wurde mit völlig fehlgeleiteten Erwartungen lokale Bürgerentscheide ins Feld geführt. Auch der erste Versuch zum Thema gebührenfreie Kitas einen landesweiten Volksentscheid herbeizuführen endete unbefriedigend vor dem Verfassungsgerichtshof. Die Möglichkeit zu etablieren, dass Volk über Fragen mit großer finanzieller Reichweite abstimmen zu lassen, war vielen vor allem aus der CDU dann doch zu weitgehend.
Aus dieser Zeit wurden mehrere Lehren gezogen:
- Bürgerbeteiligung braucht ein hochgradig vorsichtiges Erwartungsmanagement
- Beteiligung heute muss möglichst viele Gruppen und Stimmen integrieren, und
- Prozesse der direkten Demokratie sind wegen ihrer weitgehenden Unkontrollierbarkeit als nicht zu unterschätzendes Risiko zu sehen.
Vor diesem Hintergrund ist die neue Agenda der Politik des Mitwirkens einzuordnen. Sie will von der Absicht her nichts zurückdrehen, sondern Verfahren verfeinern und mehr Kontrolle gewinnen, um eine Mindestqualität der demokratischen Debatte zu sichern.
So steht im Koalitionsvertrag, dass es auf Landesebene die Möglichkeit geben soll, nach einem erfolgreichen Volksantrag (40.000 Unterschriften) zunächst einen Bürgerrat mit ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern stattfinden zu lassen. Dieser kann den Vorschlag der Initiative bearbeiten und den weiteren Prozess damit qualitativ prägen. Danach kann dann immer noch ein landesweites Volksbegehren angestrebt werden. Generell ist im Koalitionsvertrag angekündigt, zu allen wichtigen Gesetzentwürfen der Landesregierung Bürgerräte einzusetzen. Auch auf lokaler Ebene gibt es Bestrebungen, die direkte Demokratie mit dialogischer Beteiligung zu verknüpfen. Dialog soll künftig vor Bürgerentscheiden stehen, mit dem Ziel, die Polarisierung abzumildern. Wie genau diese Verknüpfung ausgestaltet werden kann, ist bisher aber noch völlig unklar. Weiter soll bei Bürgerentscheiden ermöglicht werden, auch über alternative Lösungen abzustimmen.
Die Ziele hinter diesen Vorhaben sind auch aus Sicht von Mehr Demokratie unterstützenswert, die Ausgestaltung sollte aber unbedingt die nötigen Voraussetzungen mitdenken.
Denn gute Beteiligung muss sich heute angesichts eines zusätzlichen Konflikts bewähren: Jetzt, da der Druck steigt, Maßnahmen für den ökologischen Wandel zu ergreifen, steigt auch die Ungeduld, die selben grundsätzlichen Fragen immer wieder vor Ort diskutieren zu müssen. Es lässt sich eine Tendenz beobachten, Beteiligung als zu langwierig zu sehen. Einzelne ablehnende Bürgerentscheide werden zunehmend als egoistisch-motivierte Bremsklötze bewertet und genutzt, um die direkte Demokratie an sich in Frage zu stellen.
Es ist dabei durchaus legitim, zu überlegen, die Verfahren zur Festlegung von zum Beispiel Windkraftgebieten auf eine höhere Ebene zu ziehen, um nicht auf jede Kommune warten zu müssen. Es gilt jedoch in Anbetracht dieser Tendenz sich über drei Dinge nicht zu täuschen:
- Die Motivlage der Bevölkerung ist nicht so einfach und monolithisch wie es scheint. Mehrheiten können sich gegen ein bestimmtes Projekt wie eine neue Stadtbahn oder den Bau einer Fabrik für Batterien für Elektroautos entscheiden, gerade weil ihnen eine nachhaltige Stadtentwicklung wichtig ist und das vorliegende Konzept sie nicht überzeugt.
- Auch wenn auf höherer Ebene ein bestimmter Kurs (Energiewende) entschieden wurde, kommen wir nicht darum herum, lokal zu diskutieren wie wir dieses Ziel umsetzen. Denn dazu müssen die lokalen Potenziale und Interessen vor Ort erhoben und in einem fairen Prozess unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gegeneinander abgewogen werden.
- Dass wir um die lokalen Diskussionen nicht herum kommen ist auch eine ungeheure Chance. Vor Ort kann anhand konkreter Themen die Notwendigkeit des Wandels bewusst gemacht werden. Gleichzeitig können wir in großem Stil vielfach vorhandene lokale Ressourcen aktiveren und eine neue Lust entstehen lassen, den Klimawandel zu gestalten und dabei als Gemeinschaft neue Selbstwirksamkeit zu erfahren.
Und damit sind wir bei den Voraussetzungen, dafür Beteiligung und eine zeitnahe Klimawende unter eine Hut zu bringen: Was es jetzt für die Verwaltungen im ganzen Land bräuchte, ist eine Befähigungsinitiative der Extraklasse für mehr Bürgerbeteiligung. Denn es sind die Verwaltungen in jeder einzelnen Kommune, die in den nächsten Jahren die Fähigkeit haben müssen, umfassende Beteiligungsprozesse zur ökologischen Umgestaltung vor Ort klug zu planen und umzusetzen. Nur die Verwaltungen haben den nötigen Zugang zum Wissen über die Gegebenheiten vor Ort, das nötige Personal und die nötige Zeit, die das erfordert. Jetzt fehlt „nur noch“ die innere Motivation und das nötige Prozesswissen, zu dem auch die bisher kaum genutzte Möglichkeitswelt digitaler Beteiligung gehören muss.
Die Einsicht in diese Notwendigkeit ist der blinde Fleck, der sonst in ihren Zielen zu unterstützenden Politik des Mitwirkens. Ohne den aktivierenden Fokus auf die Verwaltungen werden wir in Zukunft immer öfter und immer schneller in Blockaden hineinlaufen. Das zeigt sich auch in der Beratungsarbeit von Mehr Demokratie immer deutlicher. Bürgerinitiativen melden sich und wollen ein Bürgerbegehren gegen dieses oder jenes Gewerbegebiet starten und 30 Minuten später ist klar: Es geht eigentlich um das größere Ganze, um das jahrelange übergangen werden, um den immer mächtiger werdenden Interessenkonflikt zwischen Umwelt und Wirtschaft und um die Möglichkeit überhaupt Wünsche bei der Entwicklung einer größeren Vision für den eigenen Ort hörbar zu machen. Die Bürgerinitiativen können dann zwar versuchen, den jetzt notwendigen Prozess einer umfassenderen Bürgerbeteiligung anzustoßen, sie sind aber bei allen weiteren Schritten auf eine willige und fähige Verwaltung angewiesen.
Statt es sich leicht zu machen und die Realität aufeinanderprallender Interessen der direkten Demokratie zuzuschreiben, sollten wir dringend an unseren gesellschaftlichen Fähigkeit arbeiten, alle Wege der Beteiligung, Mitsprache und Aktivierung so zu nutzen, dass sie sich sinnvoll ergänzen. Zum Beispiel so ...
Klimawende – Top die Wette gilt!
Zur selben Zeit findet in jeder Kommune ein Bürgerentscheid dazu statt, welchen Beitrag diese spezielle Kommunen zur Klimawende leisten kann. Jede Gemeinde hat zuvor ein Jahr Zeit, analoge und digitale Prozesse der Beteiligung auf die Beine zu stellen, die das konkrete Potenzial jeder Kommune erkunden. Dann erstellt sie unter Einbeziehung möglichst vieler Menschen einen Zukunftsplan zur ökologischen Nachhaltigkeit. Es folgen umfassende Informationsveranstaltungen und kreative Formate, die diese „andere Zukunft“ nahbar und fühlbar machen – und schließlich wird per Bürgerentscheid abgestimmt. Für die Prozesse vor Ort bekommen die Kommunen alle nötige Unterstützung und werden auf Landesebene von einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne flankiert, die das große Ganze im Blick hat und grundlegende Informationen aufarbeitet.
So einen Beteiligungspfad vorzugeben, könnte eine ungeheure Dynamik auslösen und dabei klar machen: umfassende Bürgerbeteiligung und der ökologische Wandel müssen sich nicht entgegen stehen – wenn wir den richtigen Rahmen dafür setzen, befeuern sie sich gegenseitig.