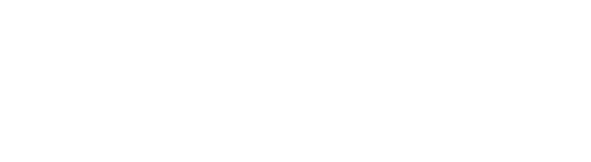Mehr Demokratie-Vorstandssprecher Ralf-Uwe Beck erhält Bundesverdienstkreuz

Mehr Demokratie-Vorstandssprecher Ralf-Uwe Beck erhält am 1. Oktober von Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz. Seit 30 Jahren kämpft Ralf-Uwe Beck für Bürgerrechte, Demokratie und Naturschutz, er hat den BUND in Thüringen mit aufgebaut und das Kunst- und Erinnerungsprojekt „Baumkreuz“ initiiert. Für Mehr Demokratie hat er in den Jahren 2000 (weitere Infos...) und 2008 (weitere Infos...) in Thüringen zwei erfolgreiche Volksbegehren zur Reform der direkten Demokratie auf Landes- und Gemeindeebene organisiert. Hier berichtet er selbst – davon, was die Menschen in der Zeit des Mauerfalls angetrieben hat, warum die Arbeit an der Demokratie noch lange nicht getan ist und warum wir die direkte Demokratie als Ergänzung zur repräsentativen brauchen.
Rede von Ralf-Uwe Beck am 6. November 2014 auf der Wartburg:
"Wir sind das Volk"
Eine Bestandsaufnahme in Sachen Demokratie
25 Jahre nach der friedlichen Revolution
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger,
für die Grenzöffnung, deren 25-jähriges Jubiläum wir in drei Tagen feiern, kann kein Wort groß genug sein: Wunder und Wahnsinn, Segen und sagenhaft. Und wer da nicht mitgehen kann, dem empfehle ich mit den Menschen im Grenzgebiet zu reden, mit denen, deren Familien über Jahrzehnte zerrissen oder die zwangsausgesiedelt wurden. Die Grenzöffnung hat uns die Seelen überlaufen lassen. Bei vielen waren es Freudentränen, bei manchen aber auch Tränen über den endlich ausgestandenen Schmerz. Dann änderte sich die Sehnsuchtsrichtung. Wir hatten Jahrzehnte durch den Fernseher über die Mauer in den Westen geschaut – der kam uns golden vor und wurde uns golden vorgehalten. Es ist nur zu menschlich, dass wir von dem Kuchen ein Stück abhaben wollten. Aber wenn es im September/Oktober noch um das tägliche Brot der Demokratie ging, um freie und geheime Wahlen, Presse- und Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Wahrhaftigkeit, also – wie der Thüringer sagt: um die Wurscht, ging es nach der Grenzöffnung mehr um die Bananen. Plötzlich tauchten Transparente auf wie „Kommt die DM nicht zu uns, kommen wir zu ihr“. Aus dem „Wir sind das Volk“ wurde „Wir sind ein Volk“. Wir kennen das alles. Es schmälert nicht Wunder und Wahnsinn der Grenzöffnung.
Mit Blick auf Gorbatschow hatten wir auf ein ex oriente lux gehofft; daraus wurde ein ex occidente luxus. Dennoch ist der Eindruck falsch, wir seien im Herbst ’89 nur darauf aus gewesen, die Mauer zum Fall zu bringen, wir seien nur aufgebrochen, um uns sobald als möglich im wiedervereinigten Deutschland wiederzufinden. Wenn wir das meinen, blenden wir das aus, was diesen Herbst ’89 so groß gemacht hat. Das war nicht nur die Grenzöffnung. Es waren die Menschen. Unser eigenes Land war uns fremd geworden. Was hatte das, was da abends über die Aktuelle Kamera flimmerte, noch mit uns zu tun. Da hat man eingeschaltet und sich gefragt, ob das jetzt noch das Sandmännchen ist. „Ja denken die denn, wir sind alle blöd?“ Jeder, der morgens um 7 Uhr im Betrieb angetreten ist, hat doch mit eigenen Augen gesehen, wie es um diesen Staat bestellt ist und musste sich dann abends sagen lassen, es gehe voran.
Wir wollten nicht sehenden Auges ins Verderben rennen. Genau diesen Kurs fährt aber ein Staat, der sich selbst in die Taschen lügt, die längst leer waren. Im Herbst ’89 sind wir unserer Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit gefolgt. Als wir aufgebrochen sind zu den Kirchen und von da aus auf die Straßen und Plätze, wollten wir uns unser Land zurückholen. Wir haben es je länger je mehr zu unserem eigenen Land erklärt und wollten uns nicht erklären lassen, wie das Land und der Sozialismus auszusehen und was für den Klassenkampf alles zu ertragen ist. Das ist übrigens der große Unterschied zu denen, die abgehauen sind, die wollten das Land hinter sich lassen. Wir wollten es uns vornehmen. Bleib im Land und nähe Dich redlich, so heißt es in einem Psalm. Daraus haben wir gemacht: Bleib im Lande und wehre Dich täglich.
Was mir erst in diesen Tagen aufgegangen ist ... dass es keine einzige Gegendemonstration von SED-Mitgliedern gab oder von der FDJ oder von Blockparteien, die ihr Land verteidigen wollten gegen all die Konterrevolutionäre, die da auf den Straßen waren. Irgendwie waren sich alle einig. Es war wie beim Treideln eines Schiffes: Alle ziehen an einem Strang und es ist völlig egal, was vorher gewesen ist, was der neben mir gewesen ist – es geht jetzt nur darum, sich aus diktatorischen Verhältnissen zu befreien. Das Bemerkenswerte ist, dass die Menschen, die sich da begegnet sind, zunächst gar nicht nachtragend waren, sie haben die anderen nicht fest gemacht daran, ob sie früher aufgemuckt oder sich weggeduckt hatten, ob sie in der Partei waren oder eben nicht. Der Aufbruch war im wahrsten Sinne des Wortes: allgemein!
Wir haben uns gegenseitig für fähig gehalten, die DDR und mit ihr die Menschen ins Freie zu ziehen. „Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht“, so steht es bei Hölderlin. Ein Irrtum, zu meinen, das Freie erschöpfe sich in der Reise- und Konsumfreiheit. Der Bedarf ist grenzenlos, aber die Erfüllung reicht nur soweit das Girokonto trägt – oder der Überziehungskredit. Erinnern wir uns heute an den Herbst ’89, dann doch nicht um des Erinnerns wegen und wegen der Anekdoten. Mir geht es darum, zu erinnern, was zu tun ist, was nicht erledigt ist, wo wir steckengeblieben sind. Was wir im Herbst ’89 erlebt haben, gehört für mich heute zur Vision einer Gesellschaft, die noch vor uns liegt: Jede und jeden als fähig anzusehen, sich für das Wohl aller einzusetzen, ausnahmslos. Ohne Ansehen der Person, unabhängig von Herkommen und Einkommen, von Ansehen und Aussehen. Diese Momente sind heute selten, wir sind eine gut sortierte Gesellschaft, die einen oben, die anderen unten. Gleichheit blitzt immerhin bei Wahlen auf: An einem Wahltag wiegt jede Stimme gleich schwer, die eines 18-jährigen genauso wie die eines erfahrungsschweren 80-jährigen, die eines erfolgreichen Unternehmers wiegt so viel wie die eines Hartz-IV-Empfängers. Nur bewusst ist uns das kaum.
Die Chance, die darin liegt, meine Stimme, meine Meinung, meine Person in die Waagschale zu werfen, haben wir im Herbst ’89 mit jeder Faser gespürt. Heute hat sich die Hälfte zurückgezogen, wieder zurückfallen lassen auf das Sofa. Was ist geworden aus unserem Ruf „Wir sind das Volk“? Schätzen wir noch dieses tägliche Brot der Demokratie oder lassen wir es hart werden? Was heißt heute: Wir sind das Volk? Wir finden den Satz im Grundgesetz wieder und in der Thüringer Verfassung, da heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Alle Staatsgewalt geht von uns aus – und fällt auf uns zurück. Was bedeutet es, wenn das Volk der Souverän ist? Was ist damit gemeint? Was ist der Staat, wer ist der Staat, wem ist der Staat? Was ist ein Bürger, eine Bürgerin? Welche Erwartung verbindet sich damit und wer erwartet hier eigentlich was und von wem? Der Staat von uns oder wir vom Staat? Ist der Staat für den Bürger da oder der Bürger für den Staat? Wie denken wir uns den Staat? Als Gegenüber, als der, der die Hand aufhält und ich muss sie füllen? Wie denkt der Staat über uns? Sind wir Steuerzahler oder Bürger? Das sind die Fragen aus dem Herbst ’89.
Wir haben die Fragen verloren damals – wir haben sie eingetauscht gegen das Begrüßungsgeld. In den Antworten auf diese Fragen können wir das tägliche Brot der Demokratie wiederfinden. Vielleicht denken Sie jetzt, „hey, was macht der für ein Fass auf!? Es geht uns doch gut, den meisten jedenfalls, im Großen und Ganzen steht Deutschland gut da, die Demokratie hat sich im Westen und bei uns seit fast 25 Jahren doch bewährt“. Ja, klar ...... aber die Hälfte der Bevölkerung lässt ihr Wahlrecht verkümmern. Die Zahl der Protestwähler steigt, in Eisenach gibt es schon Wahlbezirke, in denen die Nazis 20 Prozent einfahren. Wir beklagen einen Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen: Nach einer Forsa-Umfrage meinen 79 Prozent, dass auf die Interessen der Bürger kaum noch Rücksicht genommen werde. Nur 17 Prozent gehen davon aus, dass das Volk wirklich etwas zu sagen hat. Und 43 Prozent antworteten auf die Frage, ob Wahlen die Richtung der Politik bestimmen, mit „Nein“. Ich sehe diese Umfragewerte nicht nur negativ. Vermutlich haben sie auch etwas damit zu tun, dass Bürger kritischer werden, genauer hinschauen oder dass uns allmählich – und die Schuldenkrisen sind Geburtshelfer – dämmert, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ausnahmslos immer die Zeche zahlen. Von daher steigen unsere Erwartungen an die Politik. Wir werden kritischer. Zunehmend mehr Bürger wollen gefragt werden und sich auch ungefragt einmischen. Sie lassen Hinterzimmerpolitik nicht gelten und verlangen den Blick hinter Aktendeckel. Sie wählen launischer, wechseln die Partei wie ihre Partner. Der Bürger wird unberechenbarer. Was hier heranwächst nennen Soziologen den „schwierigen Bürger“.
Wer meint, man kann den einfach übergehen, der mag einen Blick von der Villa Reitzenstein oberhalb der Stuttgarter Innenstadt wagen; dort residiert seit einiger Zeit ein Grüner. Dorthin gebracht haben ihn die Menschen, die auf dem Stuttgarter Bahnhofsvorplatz für eine alternative Planung demonstriert haben – was die offizielle Politik nicht ernst nehmen wollte. Was ist faul im Staate Germany? Das Idealbild der repräsentativen Demokratie in Deutschland geht davon aus, dass Regierung und Opposition um die beste Lösung ringen – zum Wohle des Volkes. Eine Konkurrenzsituation, die das politische Geschäft belebt. Die Opposition hält der Regierung den Spiegel vor, in dem sich die Regierung sehen, erschrecken und ihre Positionen überdenken kann. Theoretisch. Aber der Spiegel ist längst erblindet. Es ist der Krebsschaden der repräsentativen Demokratie, so sagt es Heiner Geißler, früherer CDU-Generalsekretär, dass die Kritik, ein Vorschlag, nur deshalb nicht aufgenommen wird, weil er vom politischen Gegner stammt. Das muss auf Kosten einer sachorientierten Politik gehen. Hier wird unser Demokratieprinzip verraten. Das werden Sie am besten wissen: Wo die Sache aus dem Blick gerät und Sie Ideologien folgen, werden Sie sich nicht lange auf dem Markt behaupten können. In der Politik meint mancher, das sei gerade das Erfolgsrezept. Das ist zwar ärgerlich, aber es ist genau genommen auch völlig normal. Das Streben nach der Macht oder danach, an der Macht zu bleiben, gehört zu den Parteien wie der Wind zum geblähten Segel. Das treibt sie an.
Mitunter aber vertreten die Gewählten ein wenig mehr die Interessen ihrer Partei und etwas weniger die Anliegen der Bürgerschaft. In Wahlkampfzeiten suchen sie unsere Nähe, später dann – so empfinden es viele Bürgerinnen und Bürger – das Weite. Einholen können wir sie erst zur nächsten Wahl, dann, ja dann können wir das Kreuz ja an einer anderen Stelle machen. Was die Menschen wahrnehmen, findet sich dann in einem der resignativsten aller Sätze mitten in einer Demokratie: „Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen.“ – Das ist weit weg von diesem „Wir sind das Volk.“ – Die Resignation bezieht sich nicht nur auf „die da oben“, sondern auch darauf, dass oben und unten nicht mehr in Frage gestellt wird. Wer so redet, konstatiert nicht nur, er hat sich abgefunden. 1867-69 kam es in Zürich zu einem Volksaufstand, ähnlich dem Herbst ’89. Seit 1849 konnten die Schweizer sich Repräsentanten wählen. 20 Jahre später waren sie enttäuscht und verbittert über die Kluft, die sich zwischen den Regierenden und den Regierten aufgetan hatte. Der Philosoph Friedrich Albert Lange schrieb damals: „Eine ungewöhnlich tiefe Verstimmung über die schroff hervorgetretenen Mängel des Repräsentativsystems“ sei der wichtigste Grund für die „Erschütterung der Gemüther“ gewesen. Die Züricher haben die repräsentative Demokratie aber nicht wieder abgeschafft, sondern ... – noch einmal Albert Lange, diese „tiefe Verstimmung“ habe das Prinzip der direkten Gesetzgebung hervorschießen lassen, „wie den Kristall aus einer gesättigten Lösung“. Auf Thüringisch: Die Züricher Handwerker, Bauern, Arbeiter und auch Intellektuellen hatten die Schnauze vom Missbrauch der Demokratie gestrichen voll. Sie haben nach einem Mittel gesucht, dass die Volksvertreter zwingt, das Volk zu vertreten, damit die halten, was sie versprochen haben. Sie haben es in der direkten Demokratie gefunden.
In der Schweiz treten Gesetze erst nach 100 Tagen in Kraft – vorausgesetzt, es werden nicht 50.000 Unterschriften gegen das Gesetz binnen dieser 100 Tage eingereicht. Liegen die aber vor entscheidet das Volk, ob das Gesetz in Kraft treten soll oder eben nicht. In der Konsequenz redet die Politik in der Schweiz sehr lange über das, was sie vorhat – und, noch ein Effekt: sehr verständlich. Das ist ein scharfes Damoklesschwert über den Gewählten, die mehr mit dem Volk reden und weniger über die Köpfe hinweg entscheiden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, wenn die Politik ein Thema nicht aufgreift, selbst initiativ zu werden, selbst einen Gesetzentwurf vorzulegen und mit 100.000 Unterschriften zur Abstimmung zu bringen. Das Volk kann also immer das erste und das letzte Wort haben, kann Politik korrigieren und selbst Themen setzen, die die Politik nicht anfassen will. Das verunsichert Politik, aber es stabilisiert sie auch. Denken Sie an den Gotthard-Tunnel im Vergleich zu Stuttgart 21. Ab einer bestimmten Investitionssumme kann in der Schweiz nur noch das Volk entscheiden. Es hat zweimal abgestimmt und der Weg ist frei für den Gotthard-Tunnel. Allein die Möglichkeit, dass eine Frage, ein Projekt allen zur Entscheidung vorgelegt werden könnte, steigert die Akzeptanz politischer Entscheidungen. Es liegt immer offen, wofür Steuern ausgegeben werden.
In Deutschland meint man, würde das Volk, wenn über Finanzen abgestimmt wird, sich Freibier beschließen. Dabei stellen sich nachweislich ganz andere Effekte ein. Die Bürger sind sparsamer als ihre Repräsentanten. Um einem Missverständnis vorzubeugen. Ich will nicht Schweizer Verhältnisse. Es geht nicht darum, die Schweiz zu kopieren, wir können aber kapieren, wie die Fronten zwischen denen, die regieren und denen, die regiert werden, überwunden werden können. Allein wenn das Volk beanspruchen könnte, wenn es wöllte, selbst zu entscheiden, die Macht, die wir in Wahlen an die Politiker delegieren, punktuell wieder zurückzuholen, dann macht das die repräsentative Demokratie repräsentativer. Dieser Vision hänge ich an. Es wird dann weniger über unsere Köpfe hinweg entschieden und mehr mit uns geredet. Dieses Demokratieprinzip wollte auch der Zentrale Runde Tisch der DDR. Im Dezember 1989 hatte er die Arbeit an einer Verfassung für eine neue DDR begonnen. Im März war sie fertig und wurde der Volkskammer übergeben. Ganz selbstverständlich waren dort für nationale Fragen Volksbegehren und Volksabstimmungen vorgesehen.
Die Verfassung des Runden Tisches ist nie in Kraft getreten, die Vorschläge aber sind in die Beratungen der Gemeinsamen Verfassungskommission eingeflossen, explizit auch die zum Ausbau der Demokratie. Nur übernommen wurden sie nicht. Für den Fall der Wiedervereinigung hatten die Mütter und Väter des Grundgesetzes vorgesehen, an die Ausarbeitung einer gemeinsamen Verfassung zu gehen und die dem Volk auch vorzulegen. Dies wäre eine Chance gewesen – wir hätten uns gemeinsam, Ossis und Wessis, dieses vereinigte Deutschland in einem großen Verfassungsgespräch zu eigen machen, überlegen können, wie wir verfasst sein wollen. Ein Volk hat der Regierung eine Verfassung vorzuschreiben, nicht die Regierung dem Volk Vorschriften zu machen, so sagt es die Philosophin Hannah Arendt. Immerhin wurde die direkte Demokratie in alle Länder- und Kommunalverfassungen Ostdeutschlands von Anfang an aufgenommen. Das hat auch auf den Westen ausgestrahlt. Bis 1989 gab es beispielsweise die direkte Demokratie in den Gemeinden nur in Baden-Württemberg und Volksbegehren. Heute haben wir in ausnahmslos allen Bundesländern die direkte Demokratie auf Gemeindeebene – hier heißt das Bürgerbegehren und Bürgerentscheide – und auf Landesebene die Volksbegehren und Volksentscheide, die Gesetzgebung aus der Mitte des Volkes.
Vorenthalten wird uns bis heute, über bundespolitische Fragen direkt abzustimmen. Wir sind das einzige Land der Europäischen Union, das noch keinen nationalen Volksentscheid erlebt hat. Es gab bisher zwölf Versuche im Bundestag, mit einer Grundgesetzänderung bundesweite Volksentscheide einzuführen. Dies ist bisher an der starren Haltung der Unionsfraktion gescheitert. Hauptgegenargument: Die Sachverhalte auf Bundesebene seien so komplex, die könnten nur Berufspolitiker verstehen, bearbeiten und entscheiden. Da erklären sich Politiker zu Hohepriestern, die allein die Geheimdinge verstehen. Nur dass es da um unser Schicksal geht. „Es ist eine Irrlehre“, sagt Olof Palme, ermordeter schwedischer Ministerpräsident, „dass es Fragen gibt, die für normale Menschen zu groß oder zu kompliziert sind. Akzeptiert man einen solchen Gedanken, so hat man einen ersten Schritt in Richtung Technokratie, Expertenherrschaft, Oligarchie getan. Politik ist zugänglich, ist beeinflussbar für jeden. Das ist der zentrale Punkt der Demokratie.“ Faire Bürgerrechte sind bis heute – auch in Deutschland – keine Selbstverständlichkeit, sie müssen erkämpft werden. Nehmen wir Thüringen als Beispiel: Die Hürden für Bürger- und Volksbegehren waren beinahe unüberwindbar. Erst mit zwei Volksbegehren haben die Bürger Reformen durchgesetzt. Heute können sich die Menschen in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen – und sie tun es auch.
Auch unser Wahlrecht ist verbesserungswürdig; da sind andere Länder weiter. Wir können nur zu den von den Parteien aufgestellten Listen ja oder nein sagen, friss oder stirb. Ich möchte aber nach den Personen schauen, springen zwischen den Listen, mich nicht nur nach parteipolitischer Farbe orientieren, sondern danach, ob jemand das Herz an der richtigen Stelle und auch den Arsch in der Hose hat, zu sagen, was zu sagen, zu tun, was zu tun ist.
Worauf ich hinaus will im 25. Jahr seit Revolution und Grenzöffnung: Wenn wir aufhören die Demokratie zu entwickeln, fängt die Demokratie an, aufzuhören. Ich verfolge kein konkretes politisches Vorhaben, ich will kein Projekt durchsetzen oder verhindern, es geht im Kern um Menschenwürde. Vom Herbst ’89 ist über all die Jahre das für mich zu dem Thema geworden: Wie sehen Menschen, Menschen an, was trauen wir uns gegenseitig zu? Was gehört zu einem selbstbestimmten Leben? Wann empfinden wir uns als frei? Wie können wir dem näher kommen, was uns als Menschen ausmacht, die nicht nur funktionieren wollen, sondern mittun, dass das, was sie für sinnvoll erachten, funktioniert?! Wie lässt sich das eigentliche Kapital, die Entschlossenheit, die Kreativität, die Herzenswärme der Menschen zum Klingen bringen? Das ist eine Frage, die sich eine Gesellschaft und auch Unternehmen stellen sollten. Gerade Unternehmen gehen heute vornweg, gehen Risiken ein, experimentieren und befreien ihre Angestellten von der Präsenzpflicht, vom Zeitkorsett, schon gibt es – auch in Deutschland – Beispiele, wo Mitarbeiter selbst einschätzen, wie viel Urlaubstage sie brauchen.
Es gibt keinen Grund, den Menschen zu misstrauen, vielmehr sollten wir ihnen zutrauen, dass sie alles, was sie mitbringen, auch einsetzen – auf ein verabredetes Ziel hin, das ihnen einleuchtet. Die Erfahrungen scheinen bahnbrechend, für beide Seiten: das Unternehmen profitiert im wahrsten Sinne des Wortes und die Menschen fühlen sich wohler, sind gesünder und arbeiten gern. Wenn wir tatsächlich alle Möglichkeiten haben, uns einzubringen, mehr Einfluss haben, wen wir zum Volksvertreter wählen, notfalls selbst entscheiden können – dann vergehen uns die Ausreden. Ein Satz wie „Die da oben machen doch sowieso was sie wollen.“ fällt dann auf mich zurück, weil ich denen da oben ja Beine machen könnte. Dann kann wirklich sein, was hier angeschrieben steht: Blost Dich der Wind – so blos dagegen. Wie Du kannst – so wolle. Was ich einem Menschen zutraue, sagt nicht viel aus über den Menschen, der vor mir steht, aber sehr viel über mich selbst. Wir sind im Herbst ’89 aufgebrochen, aber wirklich frei werden wir erst sein, wenn wir die Verhältnisse unter denen wir leben selbst verändern können, wenn uns unsere Meinung nicht übel genommen wird, jede Kritik, jeder Vorschlag als Bereicherung empfunden wird – und nicht als störend. Wenn wir offen reden, wenn wir sagen können: ich stehe hier und stehe ein für das, was ich zu sagen habe.
Das alles hat gerade erst angefangen. Vielen Dank.